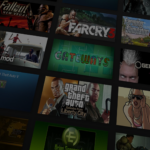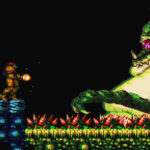Entweder ist die Open World von Final Fantasy VII Rebirth perfekt, oder sie gehört zum langweiligsten Scheiß, den das Genre je gesehen hat. Darüber gehen die Meinungen auseinander, auch wenn das Spiel insgesamt außergewöhnliches Lob erhalten hat. Während der zweite Teil der Neuauflage die Geschichte nahtlos aufnimmt, stellt die offene Spielwelt einen Bruch mit dem Vorgänger dar.
Final Fantasy VII Remake verlief ziemlich linear mit wenigen Seitenpfaden, Rebirth hingegen sprengt alle Barrieren mit offenen Arealen. Es hat dabei mehr mit einem typischen Ubisoft-Spiel gemeinsam als mit dem, was wir von Final Fantasy gewohnt sind. Mit der Offenheit kommen auch die Icons auf der Karte und mit den Icons kommt der Grind. Wie der Grind allerdings kommt, weicht auf interessante Weise von den Standards ab. Man könnte sagen, Rebirth hat den Grind veredelt. Wie das gelingt, ist einen psychologischen Blick wert.
Unkraut jäten
Wer grindet, wiederholt über einen längeren Zeitraum immer wieder die gleichen Spielvorgänge, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. So definiert die USK Grinden in ihrem Glossar. Elizabeth Lawley, Professorin für Interactive Games and Media am Rochester Institute of Technology, beschrieb den Prozess in ihrem Blog – etwas poetischer – als sinnfreie Produktivität. Grinden ist, so Lawley, wie Unkraut jäten: Für die einen lästig und langweilig, für andere eine angenehm hirnlose Aktivität, die zuweilen meditativ sein kann. Das Unkraut von Rebirth sind seine Icons auf der Weltkarte, hinter denen sich kleine Aktivitäten verbergen. Besiegte Feinde verlieren Rohstoffe, die per Crafting-System in nützliche Gegenstände überführt werden. Natürlich gibt alles auch Erfahrungspunkte. Der Grind wird schon in der Beschreibung fühlbar. Der besondere Kniff kommt aber noch.
Das Team hinter Rebirth hat sich bei all diesen Spielelementen einen zusätzlichen Feinschliff erlaubt, der den Open-World-Grind ungewöhnlich motivierend gestaltet. Ein Icon auf der Karte kann zum Beispiel eine Monster-Mission sein, für die ich einen Kampf absolvieren muss. Oder es handelt sich um eine Ausgrabung, bei der mein Chocobo vergrabene Gegenstände erschnüffeln soll. Diese Aktivitäten stehen in Rebirth nicht für sich allein, sondern sind Teil einer Kette von Aufgaben, die wir komplettieren können.
Es handelt sich dabei buchstäblich um eine Kette von Punkten, die miteinander verbunden sind. In dieser Visualisierung füllt jede absolvierte Aufgabe einen leeren Punkt mit kräftiger gelber Farbe aus – ein Prozess, der mit einer kleinen Animation angenehm in Szene gesetzt wird. Dabei nimmt die Kette zugleich die Funktion eines Ladebalkens ein, der den aktuellen Fortschritt bis zur Vervollständigung anzeigt. Anders als bei einem gewöhnlichen Ladebalken sind alle Punkte als einzelne Elemente erkennbar. Wir können sie sogar abzählen, um genau herauszufinden, wie viele uns noch fehlen. Das mag alles noch recht simpel klingen, psychologisch ist es aber ziemlich clever.

Zunächst ordnet dieses System jede Aktivität in ein großes Ganzes ein. Das wird narrativ zusätzlich dadurch gerahmt, dass wir im Spiel den Auftrag bekommen, sogenanntes World Intel zu sammeln. Die Aktivitäten sind also einem höheren Ziel zugeordnet. Dieser Kniff reicht aus, um aus vereinzelten Aktivitäten für viele von uns eine sinnstiftende Tätigkeit zu machen. Für das Erleben von Autonomie beim Spielen ist das ein wichtiger Faktor. Tätigkeiten, die uns Autonomie vermitteln, tun wir nämlich gern. Deshalb gilt Autonomie auch als eines von mehreren psychologischen Grundbedürfnissen. Wie der Psychologe Scott Rigby auf der GDC 2017 gut beschrieb, genügt Handlungsfreiheit aber nicht, um Autonomie zu erzeugen. Die Handlungen müssen für uns auch sinnstiftend sein. Autonom fühlen wir uns also nicht, wenn wir frei darin sind, zu entscheiden, ob wir Monster bekämpfen oder Zeug ausgraben. Das gelingt, so Rigby, erst dann, wenn wir wirklich wollen, was wir tun. Icons auf einer Karte eröffnen zwar viele Möglichkeiten, aber liefern noch keine guten Gründe, warum wir uns für sie interessieren sollten. Zugegeben, eine Kette gelber Kugeln und die Ausrede einer Geschichte dahinter sehen nicht nach großen Zaubertricks aus. Sie genügen aber, um arbiträren Aktivitäten einen größeren Sinn zu geben. Sie geben uns bessere Gründe dafür, sie zu wollen.
Die Kette nutzt zudem einen psychologischen Trick aus, der als Ovsiankina-Effekt bekannt ist. Die Psychologin Maria Ovsiankina stellte in den 1920er Jahren fest, dass Menschen eine Tendenz haben, unterbrochene Handlungen wieder aufzunehmen, wenn sie ihr Ziel dabei noch nicht erreicht haben. Diejenigen, die an Grind und Komplettierung interessiert sind, erinnert die Kette stets daran, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Falls das ursprünglich gar nicht unser Anliegen war, kann die Sunk-Cost-Fallacy dazu beitragen, dass wir uns das Ziel rückwirkend doch noch setzen. Dabei handelt es sich um eine kognitive Verzerrung, die Menschen dazu veranlasst, immer mehr in eine Aktivität zu investieren, wenn sie vorher bereits darin investiert haben (z.B. Geld oder Zeit). In Rebirth funktioniert das so: Die Kette zeigt uns, dass wir fünf von zwanzig Aktivitäten bereits abgeschlossen haben. Wir haben also schon etwas Zeit und Mühe investiert. Den Rest nun liegen zu lassen, kann eine kognitive Dissonanz erzeugen – wir sind entweder ein Idiot, der eine Sache angefangen und nicht zu Ende gebracht hat, oder wir machen jetzt noch die anderen fünfzehn Aktivitäten und können anschließend wieder in den Spiegel schauen.

Es ist also wahrscheinlich, dass wir uns irgendwann das Ziel setzen, das World Intel zu komplettieren. Entweder, weil wir im Sinne des Gamer Motivation Models einfach persönlichkeitsbedingt Completionists sind, die grundsätzlich daran interessiert sind, Spiele so vollständig wie möglich zu spielen. Oder eben weil die psychologischen Mechanismen des Spieldesigns es uns nahelegen. Sogar der kritische Spielejournalist Jason Schreier schrieb, dass er nach 80 Stunden Spielzeit nochmal ins Spiel zurückkehrt, um liegengelassene Aufgaben wieder aufzunehmen.
Hilfreich für die Motivation ist auch, dass Rebirth seine offene Spielwelt in mehrere Bereiche untergliedert. Das teilt auch die Suche nach World Intel in mehrere, überschaubare Abschnitte auf. Erscheint uns eine Aufgabe nämlich zu schwierig oder zu mühselig, ist es wahrscheinlicher, dass wir sie abbrechen. Eine überschaubare Aufgabe von mittlerer Schwierigkeit hält uns hingegen bei der Stange. Das ist unter anderem auch eine gute Voraussetzung für den Flow-Effekt beim Spielen.
Ein Klopfen auf die Schulter
Liz Lawley, die Professorin aus Rochester, beschrieb Grinden als sinnfreie Produktivität, aber das war noch nicht alles, was sie dazu zu sagen hatte. Sie fügte hinzu, der Grind sei ein „bleibender Beweis ihrer Bemühungen”. Hinter diesem Gedanken verbirgt sich ein weiteres psychologisches Grundbedürfnis: das Erleben von Kompetenz und Selbstwirksamkeit. Damit spricht Rebirth neben Autonomie bereits das zweite von drei Grundbedürfnissen an, die in der Selbstbestimmungstheorie formuliert werden – die wahrscheinlich größte und am besten untersuchte Motivationstheorie überhaupt. Handlungen, die uns das Erleben von Kompetenz vermitteln, tun wir gern. Wir sind motiviert, sie zu wiederholen, wenn sie uns dafür mit dem Gefühl von Selbstwirksamkeit belohnen. Das passiert immer dann, wenn wir dazu in der Lage sind, Hindernisse zu überwinden und Herausforderungen zu meistern – also wenn wir einen Bossgegner bezwingen, versteckte Gegenstände finden oder Quests zur Zufriedenheit des Spiels und seiner NPCs erledigen. Dabei ist wichtig, dass die Aufgaben klar sind und weder zu leicht noch zu schwierig. Finden wir sie zu einfach, bleibt das belohnende Gefühl aus; sind sie zu schwierig, scheitern wir vielleicht und geben auf. Ein herausragendes Beispiel dafür, wie die Vermittlung von Kompetenzerleben in Games eingesetzt werden kann, um Spieler:innen zu motivieren, ist Dark Souls. Zwar nimmt From Software in Kauf, einige Spieler:innen an den hohen Schwierigkeitsgrad zu verlieren. Doch diejenigen, die am Ball bleiben, werden mit einem besonders starken Gefühl von Kompetenz und Selbstwirksamkeit belohnt.
Rebirth geht einen anderen Weg und riskiert dabei deutlich weniger, Spieler:innen zu verlieren. Aufgaben mittlerer Schwierigkeit reichen völlig dafür aus, ein moderates Gefühl von Kompetenz zu erzeugen. Um das zu gewährleisten, gibt es sogar einen neuen, dynamischen Schwierigkeitsgrad, der das Ziel hat, die Kämpfe im Spiel stets auf einem mittleren Niveau zu halten (was auch dem Flow zugutekommt). Es reicht aber noch viel weniger, um uns das wohlige Gefühl zu vermitteln, Könner:innen zu sein. Zum Beispiel kleine gelbe Punkte.

Wir haben uns die Genialität der Ketten aus gelben Punkten bereits angesehen. Aber dieses Geschenk hört nicht auf zu geben, wenn es um unsere Motivation geht. Dabei stellt jeder ausgefüllte Punkt nicht nur den Fortschritt auf unserem Weg zum vollständigen World Intel dar, sondern ist jedes Mal eine kleine Rückmeldung des Spiels, dass wir uns beim Spielen gut anstellen. Der Abschluss einer Aufgabe ist sozusagen aus sich selbst heraus belohnend, weil wir dadurch wissen, dass wir etwas richtig machen. Das ist, als würden unsere Eltern uns auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie stolz auf uns sind. Ein gutes Gefühl.
Wer schon viele Games gespielt hat, wird jetzt einwenden, dass solche kleinen Belohnungen natürlich keine Besonderheit von Rebirth sind – und hätte Recht damit. In manchen Spielen bekommt man Erfahrungspunkte, in anderen Gold, Geld, Rubine oder Pokédollar. Diese Belohnungen haben alle etwas gemeinsam: es handelt sich um Tokens.
Tokens werden in der Psychologie häufig eingesetzt, um ein Verhalten zu verstärken. Sie haben selbst keinen eigenen Wert und sind beliebig austauschbar. Sie können aber gegen andere Dinge eingetauscht werden, die uns mehr bedeuten, zum Beispiel ein mächtiges Schwert oder eine nützliche Fähigkeit. Insofern ist auch reales Geld nichts anderes als ein Token-System.
Ein solcher generalisierter Verstärker hat viele Vorteile. Man muss sich beispielsweise nicht damit befassen, was einer Person wirklich wichtig ist, um sie geeignet zu verstärken. Sie kann ihre Tokens ja entsprechend eintauschen. Die Sache hat aber auch einen Haken: extrinsische Motivatoren wie Gold und Erfahrungspunkte, die nichts mit dem eigentlichen Spielprinzip zu tun haben, können die intrinsisch motivierte Freude am Gameplay zerstören. Das heißt, ich stürze mich nicht mehr in Monsterkämpfe, weil mir das Kampfsystem Freude macht, sondern weil ich Gold dafür bekomme, mit dem ich mir irgendetwas kaufen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen hat Rebirth eine Lösung für dieses drohende Problem gefunden.

Die Forscherinnen Barbara Marinak und Linda Gambrell konnten beispielsweise zeigen, dass die Motivation, Bücher zu lesen, bei Kindern vermindert wurde, wenn man sie für das Lesen mit Geld belohnte. Sie lasen dann nur noch, wenn sie dafür abkassieren konnten. Belohnte man sie hingegen mit Büchern, lasen die Kinder häufiger auch ohne neue Belohnungen weiter.
Rebirth macht das ganz ähnlich: erfolgreich abgeschlossene Kampfmissionen schalten beispielsweise neue Kämpfe frei und die Erkundung von Heiligtümern verbessert die Beschwörung der dazugehörigen Gottheit. Die Art der Belohnung hat etwas mit der Tätigkeit selbst zu tun oder steht in einer engen Verbindung zu ihr. Die Belohnungen fühlen sich oft besser an, weil sie nicht so generisch sind wie Geld oder Erfahrungspunkte – und sie halten unsere intrinsische Motivation viel besser am Leben.
Doch selbst diese veredelten Open-World-Aktivitäten haben das ein oder andere Problem im größeren Kontext des Spiels. Denn stundenlanges Auskundschaften und die Jagd nach World Intel stehen in einer widersprüchlichen Beziehung zur Dramaturgie der Geschichte. Anders ausgedrückt: Wer eigentlich grad die Welt retten will, sollte nicht so lange rumpimmeln. Hier wird die ludonarrative Dissonanz – der Widerspruch zwischen der narrativen Dramaturgie einerseits und den Spielhandlungen andererseits – sehr fühlbar. Diese Schwäche teilt sich Rebirth durchaus mit den meisten Open-World-Spielen. Das ausgeklügelte Design steht dem Spiel an dieser Stelle sogar im Wege. Zwar könnte man sagen, dass Spieler:innen frei darüber entscheiden dürfen, wie viel Zeit sie in Nebenaktivitäten investieren wollen. Das motivierende Spieldesign macht es jedoch schwierig, dem Grind zu widerstehen.
Zu Gast bei Freunden
Vielleicht hätte sich Rebirth – wie sein Vorgänger – viel mehr auf seine Geschichte verlassen können, die von einem breiten Arsenal an Figuren getragen wird. Das wachsende Ensemble vermittelt das gesellige Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die durch Freundschaft und gemeinsame Abenteuer miteinander verbunden ist. Als Spieler:in sind wir irgendwie ein Teil davon.
Tätigkeiten, bei denen wir uns mit anderen verbunden fühlen, weil wir uns selbst als bedeutsam für andere erleben oder andere als bedeutsam für uns, tun wir gern. Wir sind also intrinsisch dazu motiviert, Dinge immer wieder zu tun, wenn wir uns durch sie sozial verbunden fühlen. Dabei handelt es sich übrigens um das dritte und letzte Grundbedürfnis, das in der Selbstbestimmungstheorie formuliert wird.

Ohne ein soziales Gegenüber gelingt das über den Mechanismus der parasozialen Interaktion. Verbringen wir viel Zeit mit virtuellen Figuren, gewöhnen wir uns an sie und können uns sozial eingebunden fühlen, auch wenn wir ihnen nur zusehen. Ein gutes Beispiel dafür sind Influencer:innen. Lange bevor Fans auf Twitch mit ihren Idolen per Chat in Kontakt treten konnten, waren Beziehungen zu Stars und anderen Medienfiguren vollständig parasozial (und sie sind es zu einem Großteil weiterhin, auch wenn unsere Chatnachrichten mitunter live vorgelesen werden). Das heißt, wir können das Gefühl haben, eine Person gut zu kennen oder uns mit ihr verbunden fühlen, obwohl diese Person vielleicht nicht einmal weiß, dass wir existieren. Vielleicht habe ich Einblicke in ihr Wohnzimmer bekommen oder dieser Person einen Energy-Drink abgekauft. Sie hingegen würde mich nicht einmal erkennen, wenn ich sie auf der Straße anspreche. Die Beziehung ist einseitig oder jedenfalls sehr asymmetrisch, fühlt sich aber sozial an.
Wir können uns sogar sozial verbunden fühlen, wenn wir ein Buch lesen oder Singleplayer-Games spielen. Das funktioniert vor allem dann, wenn Spiele ihre Figuren in den Vordergrund stellen, wie etwa Baldur’s Gate 3 oder Dragon Age. Rebirth erzielt diesen Effekt durch Dialoge zwischen den Party-Mitgliedern und Figuren-bezogene Erzählstränge. Ich bin dabei, wenn Cloud und seine Truppe abends schlafen gehen und auch wenn sie am nächsten Morgen von Shinra-Soldaten überrascht werden. Ich verbringe einen Tag am Strand mit ihnen und helfe ihnen beim Aussuchen ihrer Outfits. Ich gehe mit ihnen durch dick und dünn – und das für 40 oder 80 Stunden. Das ist mehr Zeit, als wir benötigen, um ein Buch zu lesen oder alle Staffeln Stranger Things zu schauen. Wenn eine Figur also kein absoluter Baumstumpf ist, verwundert es kaum, dass wir uns nach viel gemeinsamer Zeit ein wenig mit ihr verbunden fühlen. Keine Sorge übrigens: solche Gefühle sind völlig normal.
Veredelter Grind
Ob der Grind von Rebirth – veredelt oder nicht – ästhetisch und spielerisch wertvoll ist oder eben doch nur Zeitverschwendung, darüber lässt sich vermutlich streiten. Es lässt sich bei aller Spielfreude sogar einwenden, dass eine zu starke Spieler:innenbindung eine Computerspielabhängigkeit begünstigen könnte. Für Rebirth aber würde ich Entwarnung geben: Zwischen Vollpreis-Service-Games und ausbeuterischen Free-to-Play-Titeln tut sich Rebirth als klassisches Singleplayer-Spiel hervor. Es hat einen Anfang und ein Ende und verzichtet darauf, euch über zusätzliche Käufe zu melken. Insbesondere versteckt es keine hilfreichen Spielfeatures hinter Ingame-Käufen. Entlang dieser Aspekte verläuft die Linie, anhand der wir motivierende Spiele von ausbeuterischen trennen können.
Und wenn ihr, wie ich, keinen eigenen Garten habt, in dem ihr zur Erholung etwas Unkraut jäten könnt, dann ist der Open-World-Grind von Rebirth vielleicht genau das Richtige.